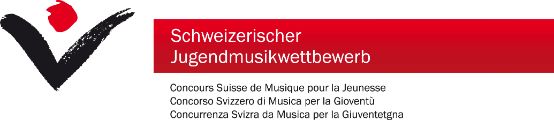
Le plus important, c’est la sonorité à venir
Ein Gespräch mit dem Komponisten Xavier Dayer, der im Rahmen eines Kammermusik-Meisterkurses mit Preisträgern des SJMW an seinen Werken arbeitet.
Hans-Ulrich Munzinger — Vor drei Jahren war es Fabian Müller, letztes Jahr Klaus Ospalt, dieses Jahr hat der Schweizer Komponist Xavier Dayer die Einladung angenommen, mit 1. Preisträgern des SJMW an einem Kammermusik-Meisterkurs zu arbeiten. Dayer, Komponist eines grossen Repertoires, das meist aus Aufträgen entstanden ist, unterrichtet Musiktheorie und Komposition an der HKB Hochschule der Künste Bern und ist Studiengangleiter. Damit setzt der SJMW die Idee fort: Jugendliche InstrumentalistInnen erhalten die Möglichkeit, einen zeitgenössischen Komponisten persönlich kennenzulernen und mit ihm zu arbeiten. Musik lebt aus der Begegnung!
Was wird Xavier Dayer mit den Jugendlichen arbeiten? «Ich habe viele Kammermusikwerke geschrieben, unter anderem für die swiss chamber soloists. Um diese Werke vor allem geht es im Kurs. Ich habe die wertvolle Mitarbeit von Instrumentalisten, die mithelfen, die Werke zu erarbeiten. Mir selber geht es vor allem darum, den Notentext lebendig werden zu lassen.» Musik «lesen», sagt Dayer, sei eine schwierige Sache. «Il faut comprendre que chaque moment est la conséquence d’un autre et que chaque instant ouvre sur une sonorité inconnue. Le plus important c’est d’intérioriser cette sonorité à venir: c’est la phrase musicale, le phrasé.» Bewährte Dozenten wie der Violonist Urs Walker und der Pianist Andreas Szalatnay sind am Kurs dabei, aber auch neue wie der Oboist Matthias Arter, die Violoncellistin Elsa Dorbath, beide mit Xavier Dayer gut bekannt, und weitere. Die jugendlichen Teilnehmer werden aus den 1. Preisträgern ausgewählt und eingeladen, sie können sich aber auch selber anmelden (siehe Kasten). Thema des Kurses sind Werke des traditionellen Repertoires und eben Kompositionen von Xavier Dayer. Der Ort: Das Grand Hotel in Bad Ragaz, wunderbar gelegen am Fuss der Alpenwelt, ein sicherlich inspririerender Ort!
Wie wollen Sie, frage ich, den jugendlichen Teilnehmern das Phänomen der «Neuen Musik» erklären? Es sei, sagt Dayer eigenartig: Moderne Kunst sei überlaufen, die Leute strömten in die Museen, um die vor 100 Jahren entstandene Kunst zu sehen. Anders bei der Musik, wo die hundertjährigen Werke immer noch «neu» seien, für viele fremd und Vermittlung brauchten. Es gebe, sagt Dayer, das Phänomen der «méfiance du public». Auch für ihn war es einst ein Choc: Er erinnert sich an sein Erlebnis mit Metastasis von Xenakis, im Alter von 16 Jahren. Dass Musik keine Harmonie brauche und keinen Kontrapunkt, sondern in der Art einer Klangskulptur einen Klangfluss darstelle, das habe ihn schon sehr fasziniert. Nach der Zusammenarbeit mit Eric Gaudibert und einem Studienjahr am IRCAM in Paris hatte sich seine kompositorische Position neu formuliert. «Cantus» heisst eine Werkreihe Dayers für ein Soloinstrument. Der Titel nimmt Bezug auf die Musik der Renaissance. «Versteckte Bezüge, eben ein cantus firmus, die man aber nicht zu hören braucht, sind mir wichtig.» Das Gespräch kommt auf Ockeghem: «Auch eine schwierige, in gewissem Sinne immer moderne Musik. Sie ist 500 Jahre alt, aber deshalb nicht leichter verständlich geworden. Kein Mainstream.» Neue Musik: Man weiss nicht, an wen sie sich richten könnte. «Jedes Werk ist eine Art Liebesbrief, an die Interpreten zunächst, in der Hoffnung, dass sie verstehen und sie an den unbekannten Dritten weitergeben: das Publikum.» Es sei unmöglich, für einen «Durchschnitt» zu komponieren. Der französische Impressionismus, Weberns von Dayer bewundertes op. 6, sogar in gewissen Aspekten Wagner – vieles korrespondiert mit seiner Musikauffassung. «Ma nature comme compositeur, je pourrais tenter de la définir comme une attention extrême à la pulsation du coeur humain comme point de repère (on parlait du «tactus» à la renaissance) mélangée aux gestes et aux ornements provenant de la musique récente. On pourrait dire que je m’aventure souvent dans un univers sonore habité par l’ornementation de la musique française et le tactus souterrain de la renaissance.»
Hören – eine Urerfahrung
Das erste, sagt Dayer, was wir als Ungeborene wahrgenommen haben, war eine Hörerfahrung: eine Stimme, die der Mutter zum Beispiel. «Une annonce du futur», der Klang des Kommenden. «Eine Urerfahrung. Man ist, wenn man darüber spricht, sofort bei der Philosophie. Es ist eine Frage, wie wir unsere Kultur verstehen.» Der Klang des Kommenden beinhaltet auch das Unvorhergesehene, den Moment. Dass wir heute Musik immer wieder repetierend hören können, sei ein Komfort, der dieser Urerfahrung das Gefährliche nehme. «Musik bringt uns dazu, für eine gewisse Zeit uns auf eine andere Zeit einzulassen.» Im 19. Jhdt. waren die Welten der Gesellschaft und der Künstler (scheinbar) zusammen. Aber kann dies als generelle Regel für alle Musik gelten? Was die Bedeutung der Musik ist, beschäftigt Dayer enorm: Wir sind mit dieser Musik nicht «dans une moyenne de ce que notre société souhaiterait.» Darüber hinaus aber, beim Komponieren, ist es kein Thema. Musik: ein Kontrast zur Normalität. Nicht wiederholen, was schon da ist. Die Kammermusikwoche bietet die Chance, diese Welt kennen zu lernen.
Kammermusik für 1. PreisträgerInnen des SJMW
10. – 17. Oktober 2020, Bad RagazAlter: 15 – 20 Jahre
Mit Xavier Dayer (Komponist), Urs Walker, Andreas Szalatnay, Matthias Arter, Elsa Dorbath, Fabio Marano, Katarina Gavrilovic
Anmeldung: > www.sjmw.ch

