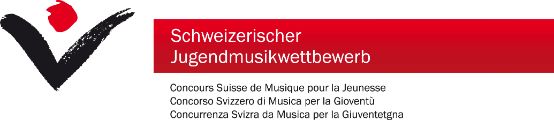
40 Jahre Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb
Preisträger aus 40 Jahren SJMW spielten am Festkonzert in der Tonhalle Zürich – und erinnern sich, wie sie als Jugendliche den Wettbewerb erlebt haben. Ein Rückblick der besonderen Art.
Auf der Bühne haben sie etwas zu sagen, im Gespräch auch. Leidenschaftliches, Virtuoses, Witziges, Anekdotisches. Wir führten Gespräche über den Wettbewerb, damals und heute. Einiges davon teilt dieser Beitrag mit.
Kurz nach der Gründung des Wettbewerbs war Thomas Grossenbacher dabei. Heute ist er Solocellist im Tonhalle-Orchester (Turnhalle-Orchester verstand er als Kind) und Professor an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK. Er, der nicht aus einer Musikerfamilie stammt, hat sich als Kind selber für die Teilnahme entschieden. Denn nach den drei ersten Cellostunden war es ihm klar: Berufsmusiker werden! Der Wunsch passte. Nicht ganz hingegen, dass er am SJMW Brahms e-moll spielen wollte, sein Lehrer aber auf Vivaldi e-moll entschied. Der überraschende 1. Preis war die Bestätigung, die Berufskarriere einzuschlagen. Sie führte an die Hochschule Lübeck, ins NDR-Sinfonieorchester und schliesslich zurück nach Zürich. Wir diskutieren die Gretchenfrage: Wettbewerbe ja oder nein? und über die Schwierigkeit, junge Musikerinnen und Musiker gerecht zu beurteilen.
Thomas Grossenbacher schätzt die Dimensionen seines Berufes, den er leidenschaftlich ausübt, von Bach bis Kagel, Brahms e-moll natürlich eingeschlossen!
Fabio di Càsola hat als Junge in der Banda civica filharmonica di Lugano Klarinette gespielt. Einen Teil des Unterrichts hat er bei sich selber genossen, da es im Tessin noch kein Conservatorio gab. Im Nachhinein ist es ihm klar: Es habe ihn gelehrt, «selber zu denken und selbständig zu werden». Der frühere Soloklarinettist im Musikkollegium Winterthur und Professor an der ZHdK hat 1979 und 1984 am SJMW teilgenommen. Es war ein Schritt aus der engeren Umgebung heraus in die Musikwelt. Der 1. Preis, den er als 17-Jähriger errungen hat, bedeutete: Anerkennung der Leistung (aber auch Kritik der Jury!) und die Bestätigung für das Studium. Wir diskutieren: Interpretationen am oder für den Wettbewerb? Was ist heute an Eigenart festzustellen? Persönliche Leistungen versus Einstudiertes? «Wir alle kopieren», meint er. Steve Jobs und Picasso hätten gesagt: «Gute Künstler kopieren, aber das Genie klaut». Fabio di Càsola, italienisch sprechender Schweizer Klarinettist mit einer französischen Klarinette, die von einem deutschen Klarinettenbauer gebaut wurde – typisch für den neugierigen und gleichzeitig pragmatischen handelnden Musiker, der auch neuster Technik nicht abhold ist. Er führt sein ganzes Repertoire in einem Tablet mit sich, das auch im Konzert zum Einsatz gelangt. Darauf ist auch ein zeitgenössisches Werk für Klarinette: Wunsch für die Zukunft, Vision.
Wozzeck steht bevor, aber im Gespräch gewinnt die Begeisterung für den SJMW die Oberhand: Nathalie Blaser, Lehrerin und freischaffende Fagottistin. Wie war es für sie damals? Ein Greenhorn sei sie gewesen, ohne den Background, den andere vielleicht hatten. Das Umfeld neu, der Wettbewerb: terra incognita. Als Sonderpreis hat sie zu ihrer Überraschung ein neues Moosmann-Fagott erhalten, auf dem sie dann viele Jahre spielte, bis weit in ihre Berufsjahre hinein. Heute schickt sie ihre Fagott-Schülerinnen an den Wettbewerb. Nicht, damit sie gewinnen, sondern weil die Erfahrung wertvoll ist: die Vorbereitung, das Vorspiel, das Zusammensein mit anderen Gleichgesinnten. Nathalie Blaser kennt den SJMW von allen Seiten: als Teilnehmerin, Lehrerin, Jurorin. So kann sie es steuern, dass die Schülerinnen den Wettbewerb nicht als Kampf erleben, sondern als Ereignis und als Markstein in der Entwicklung.
Anne-Laure Pantillon, aus einer Musikerfamilie der Romandie, vertrat am Festkonzert die jüngere Generation. «Ja, ich habe damals gerne gespielt und für den Wettbewerb besonders intensiv geübt». Die Flötistin im Luzerner Sinfonieorchester und Dozentin an der Musikhochschule Luzern erzählt, dass sie für den SJMW erstmals ein zeitgenössisches Werk gelernt hat. Dass eine Glocke zu bedienen war, war zwar etwas kompliziert, aber dank der von ihrem Lehrer entwickelten Fussglocke funktionierte es und wurde zum Erfolg. «Wettbewerbe machen!» empfiehlt sie ihren den Schülern. «Es führt einen aus der eigenen Schule heraus. Man hört andere Teilnehmer, entwickelt selber ein Programm». Aber: «Unbedingt einen Preis wollen», sagt sie, «kann gefährlich sein». Wichtig sei es, dass die Lehrer den Schüler so vorbereiten, dass sie wissen, was auf sie zukommt. «Das Vorspiel in verschiedenen Orten der Schweiz, die Fahrt auf dem Luganersee: Wie kleine Ferien!»
Entradawettbewerb 18.-20. März, Finale 5.-8. Mai
Anmeldung: 1.11.15 bis 11.12.2015
> www.sjmw.ch

