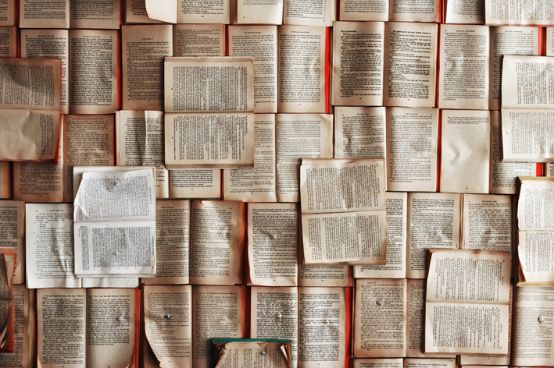
Auswirkungen in der Praxis
Zum Thema der Gehörbildung bei Geigern möchte ich diesen Ausschnitt aus Die Kunst des Violinspiels (1926) von Carl Flesch zitieren (S.11), mit welchem ich uneingeschränkt einverstanden bin:
«Nachdem wir die Saite in Bewegung gesetzt haben, gelangen die Schwingungen an unser Trommelfell, von dort zu dem die Schwingungszahl berechnenden ‹Zählapparat› und schliesslich an die Hörsphäre auf der Rinde des Grosshirns. Im Bewusstsein wird das Urteil gesprochen, der Ton wird rein oder unrein befunden. Im letzteren Falle entsteht bei dem mit scharfem Gehör begabten Spieler ein äusserst unangenehmes Gefühl, das die korrigierende Fingerbewegung auslöst. Je stärker das Unlustgefühl ist, desto stärker wird auch das Bedürfnis, die richtige Tonhöhe möglichst schnell zu erreichen. Die dadurch entstehende Veränderung der Fingerlage bewirkt eine verschiedene Schwingungszahl, und die gleichen Vorgänge spielen sich nochmals mit dem nun veränderten Ton ab.
(...)
Aus diesen Erwägungen ergeben sich die praktischen Gehörsübungen, welche ich seit Jahren bei meinen Schülern zur Anwendung bringe. Sie bestehen darin, dass der Schüler (am besten in einer Caprice von Rode in einer der Kreuztonarten) jeden einzelnen Ton so lange aushalten und auf seine Reinheit (ohne Vibrato und möglichst unter Zuhilfenahme der entsprechenden leeren Saite) untersuchen muss, bis er die unbedingte Überzeugung gewonnen hat, dass die Tonhöhe genau getroffen ist.
(...)
Ist er so weit gekommen, dann muss ihm zum Bewusstsein gebracht werden, dass die Änderung eines jeden falschen Tones für ihn als oberster Grundsatz seiner Kunst zu gelten hat, und dass die in mühseliger Arbeit erzielte Verbesserung seines Gehörs von dem Augenblick an verloren ginge, wo er durch nachlässige Beobachtung der Intonation seinen Hörapparat wieder an ungenaues Registrieren der Schwingungszahl der gespielten Töne gewöhnen würde. Man muss ihm die Überzeugung einimpfen, dass langsames Üben der technischen Schwierigkeiten ausser vielen anderen Vorteilen vor allem den Nutzen mit sich bringt, dass jeder einzelne Ton untersucht und verbessert werden kann. Er muss darauf hingewiesen werden, dass es ganz und gar keine Schande bedeute, den Finger ungenau aufzusetzen, wenn der Ton nur so rasch verbessert wird, dass die ursprüngliche, unrichtige Höhe dem Zuhörer nicht mehr recht zum Bewusstsein kommen kann. Hört der Spieler jedoch die falsche Tonhöhe, ohne sie zu verbessern, dann ist diese Unterlassungssünde in der Regel die Folge einer verhängnisvollen Gleichgültigkeit, die ihn für immer am Fortschreiten verhindert. Der Geiger vergesse nie, dass ein scharfes Gehör sein kostbarstes Gut und die wichtigste Vorbedingung höherer Künstlerschaft ist.»
Der Pädagoge Carl Flesch hat mit anderen Aspekten seiner Lehre (1) Geigerinnen und Geiger auf der ganzen Welt beeinflusst, aber er hat auch richtiggehend eine Mode geschaffen – und zwar mit einer übertriebenen Intonation, die angeblich die sogenannte «französische Art» sei (obwohl sie, im Gefolge von Joseph Szigeti und der Zigeunermusik eigentlich eher dem ungarischen Stil zuzuschreiben war), währenddem die Intonation «auf deutsche Art» wesentlich mehr temperiert war.
Aber diese Betrachtungen scheinen nicht bei allen Vertretern der französischen Violinschule vorbehaltlose Zustimmung gefunden zu haben. Diese geben zwei Dinge zu bedenken: Dass einerseits das Cis, welches man durch die reinen absteigenden Quarten E-H-Fis-Cis erhält, keinen Halbton mit der leeren D-Saite ergibt (wenn man davon ausgeht, dass ein Halbton ein durch zwei geteilter Ganzton ist), und dass andererseits die Sexte G-E, wenn sie unter Zuhilfenahme der leeren G- und der leeren A-Saite konstruiert wird, «zu gross» und daher nicht angenehm zu hören ist. Sie empfehlen, das E (erster Finger in der ersten Lage) ein wenig tiefer zu nehmen. Diese Stellung des ersten Fingers führt den Geiger automatisch zur gleichschwebend temperierten Stimmung und der Unterteilung der Quinte in sieben gleiche Halbtöne.
Als ich einmal während einer Geigenstunde bei Pierre Doukan am Conservatoire de Paris versuchte, die expressive Intonation Nathan Milsteins, welche mir seinerzeit sehr gefallen hat, zu imitieren, sah mich der erstere mit grossen Augen an und fragte mich, was denn bloss los sei mit mir. Er wollte nichts von Milstein wissen, und ich spürte, dass ich an ein Tabu gerührt hatte.
Mittlerweile habe ich verstanden, dass es falsch ist, wie Carl Flesch davon auszugehen, dass der Geiger den pythagoreischen Gesetzmässigkeiten unterworfen ist, und ich sehe klar, dass diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis eine destabilisierende Wirkung auf die Intonation hat. Und das hat schlimme Folgen, denn es scheint mir, dass Erwachsene, die sozusagen ihr Leben lang von instabiler Intonation umgeben waren, grosse Schwierigkeiten haben, sich davon zu erholen, auch wenn ihr Gehör eigentlich gute Fähigkeiten hätte. Sie sind zwar in der Lage, ein richtiges Intervall zu reproduzieren, nicht aber es zu memorieren.
Anmerkung
(1) Carl Flesch sagt nur auf Seite 4, «... dass die Geige in reinen Quinten gestimmt werden muss ...», doch ist man, so wie der Übersetzer der französischen Ausgabe, versucht, daraus abzuleiten, dass die Geige ausschliesslich nach den pythagoreischen Gesetzen gespielt werden solle. Zudem sagt Carl Flesch noch auf Seite 11: «Wir wissen z. B., dass ein Ton in seiner Eigenschaft als siebente Stufe (Leitton) höher genommen werden muss, als wenn er bloss als Terz auftritt. Wir werden daher das fis in der Tonfolge (-D-fis-A-fis-) mit der gebräuchlichen Schwingungszahl einer grossen Terz spielen, während wir es in der Tonfolge (-D-E-fis-G-) um einige Schwingungen höher spielen müssen, da es der Tonika G zustrebt.» (Wenn die gebräuchliche Schwingungszahl schon «pythagoreisch» ist, dann möchte ich absolut nicht das erhöhte fis hören! Und wenn die gebräuchliche Schwingungszahl etwas anderes ist als Pythagoras, dann ist Carl Flesch einer jener zahlreichen Geiger, welche sich nicht selbst eingestehen, dass sie eine temperierte und bewegliche Intonation spielen.

