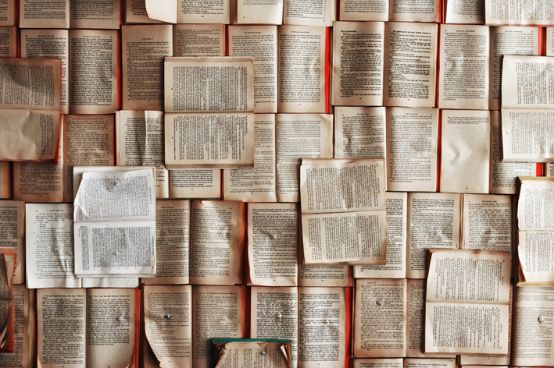
Geschichtliche Entwicklung
In der europäischen Musiktradition herrschte der pythagoreische Quintenzirkel bis zum Erscheinen des Dreiklangs im 15. Jahrhundert vor. Der Eindruck von Einfachheit und Perfektion, den dieses System auf den ersten Blick vermittelt, hat sich als illusorisch herausgestellt. Die grossen Terzen sind zu gross (1), und harmonisch ist ihr Klang an der Grenze zum Erträglichen.
Im 16. Jahrhundert entstand die mitteltönige Stimmung, die auf reinen Terzen basiert anstelle von reinen Quinten. Dieses Akkordsystem bezweckt in erster Linie harmonische Durchsichtigkeit. Es verändert ein wenig die Quinten, um dadurch reine Terzen zu erhalten: die mitteltönigen Quinten sind vier Mal weniger «falsch» als die pythagoreischen Terzen.
In der gleichen Zeit wurde in der Vokalmusik eine Technik mit wechselnder Intonation entwickelt, welche es erlaubte, gleichzeitig reine Terzen und reine Quinten zu benutzen. Diese ist eine schwierige Kunst, da sie so etwas wie «Einklang-Querstände» erfordert, was bedeutet, dass die Höhe eines gleichen Tones von Stimme zu Stimme leicht variieren kann (um ein syntonisches Komma). (2)
Im 17. und 18. Jahrhundert kamen unregelmässige Stimmungen auf (Werkmeister, Rameau etc.). Die Quinten wurden nicht alle um denselben Wert verkleinert. Die Ungleichheit der Intervalle bewirkte besondere Klangfarben, die bei jeder Tonart anders waren. Auch jede Stimmung selbst hatte einen eigenen Charakter. Dies war eine raffinierte Kunst, aber auch hier waren noch nicht alle Modulationen möglich.
Ab dem 18. Jahrhundert setzte sich mehr und mehr die temperierte Stimmung durch. Dabei werden die zwölf Quinten alle um denselben Wert verkleinert, was auch die schwierigsten Modulationen ermöglicht. Aber der Kompromiss ist nicht sehr glücklich: Die Quinten sind zu klein, die Terzen sind weder sauber noch brillant, und die Intervalle dazwischen sind ohne Glanz. Die Klavierstimmer haben immer versucht, diesen Mängeln durch Vergrösserung der Intervalle beizukommen, vor allem bei den tiefen und den hohen Tönen. (3)
Anmerkungen
(1) Das «syntonische» oder «didymische» Komma ist das Verhältnis zwischen einer pythagoreischen Terz und einer reinen Dur-Terz, das heisst zwischen 4 reinen Quinten und einer reinen Durterz+2 Oktaven:
1 Komma (S) «ungefähr gleich»* 21.6 cents (100 cents «ungefähr gleich» temperierter Halbton).(2) Hier nachzuhören: http://virga.org/zarlino/index.html
(3) Inharmonizität der Saiten und Vergrösserung der Intervalle auf dem Klavier, siehe: http://fr.wikipedia.org/wiki/Inharmonicité_du_piano
* Das mathematische Zeichen für «ungefähr gleich» kann auf dieser Website leider nicht wiedergegeben werden.

