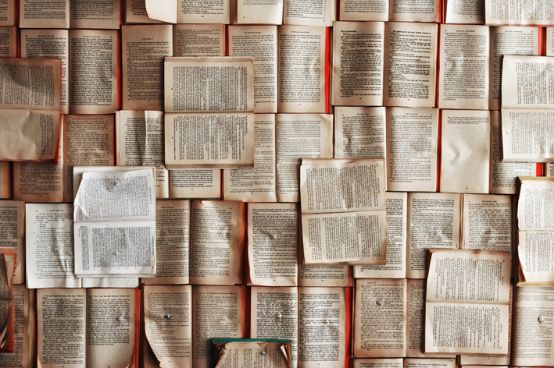
Conclusio
Manche behaupten, wir würden alle ohnehin derart falsch spielen, dass solch detaillierte Überlegungen uns nur wenig weiterhelfen könnten. Ich meine im Gegenteil, dass man unbedingt vermeiden sollte, sich für eine Intonationsdefinition zu entscheiden, die übertrieben, kompliziert oder sogar zusammenhanglos ist und dass in der Ensemblemusik unterschiedliche Intonationssysteme nicht gleichzeitig angewandt werden sollten.
Ich bin ein Verfechter der gleichschwebenden Stimmung, welche tendenziell auf Orchestermusiker eine magnetische Anziehungskraft ausübt, eben genau wegen ihrer Regelmässigkeit, die die Gesetze der Statistik zu ihren Gunsten auslegt und die es in der Folge erlaubt, die reinsten Oktaven, Quarten und Quinten zu verwirklichen, was wiederum das wichtigste Kriterium für einen guten Klang bildet. Der Vorteil der temperierten Stimmung ist ihre Präzision (1); denn sie erlaubt es den Musikern, die sich ihrer bedienen, dass sie sich die genauen Werte der Intervalle besser einprägen können.
Eine gute Intonation im Orchester beginnt damit, dass die Streicher ihre leeren Saiten überwachen und ihre Quinten in gleiche Teile aufteilen. Die Bläser werden dann keine Schwierigkeiten haben, sich einzufügen in das, was sie hören, denn niemand unter ihnen kann über seine eigene Tonhöhe sicher sein.
Jeder wird zustimmen, dass eine Intonation von hoher Qualität ganz einfach eine faszinierende Sache ist!
Natürlich sind die historischen Stimmungen ein musikalischer Schatz, den es zu bewahren gilt. Jedoch stellt die gleichschwebende Stimmung mit reinen Quinten, auch wenn die Konsonanzen theoretisch nicht ganz perfekt sind, jenes System dar, welches in der Ensemblemusik generell zur höchsten Anzahl an Konsonanzen führt, und das am besten der Musik entspricht, die wir ausüben!
Die Regel ist für den Ausübenden ganz einfach: «Gleichheit der Intervalle innerhalb einer reinen Quinte, die Quinten dürfen nicht zu gross sein, die Quarten und Oktaven nicht zu eng». Diese Regel führt in der Tat zum Kompromiss zwischen den zwei Arten, Intervalle zu temperieren (gleichschwebende Stimmung mit reinen Oktaven oder gleichschwebende Stimmung mit reinen Quinten). Wenn es am Klavier gelingt, diesen Kompromiss herzustellen, erscheint alles wunderbar rein, da die Schwebungen der Quinten und Oktaven zu langsam sind um noch hörbar zu sein. (2)
Ist das Gehör einmal in einem solcherart temperierten System gut ausgebildet, verfügt der Musiker selbstverständlich über die Freiheit, sich abhängig von der jeweils gespielten Passage, dem gewählten Repertoire und der eigenen Empfindung wieder davon zu lösen, genauso und unter den gleichen künstlerischen Gesichtspunkten wie er sich mitunter auch vom metronomischen Taktschlag entfernen kann.
Ich würde also eher davon sprechen, dass der Streicher die temperierte Tonleiter «interpretiert», aber nicht, dass er eine andere spielt, denn es gibt keinen Grund, sich auf das pythagoreische System zu beschränken, wenn man seiner Intonation «Farbe» verleihen möchte.
Es ist sehr theoretisch zu glauben, dass bei der temperierten Stimmung «alles falsch sei», denn die Abweichung um nur drei Cent bei Quinten und Oktaven ist für die meisten Musiker sowieso nicht mehr wahrnehmbar, und die anderen Intervalle sind völlig befriedigend. Dieser Kompromiss ist genial, weil er an die Grenze des Ausführbaren stösst; und es wäre schade, dies nicht auszunützen.
Es ist ebenfalls sehr theoretisch zu glauben, dass die natürliche Terz rein sei. Sie entfernt sich in einem solchen Mass von den natürlichen und pythagoreischen Werten, dass sie äusserst destabilisierend wirkt. Sie zu verwenden, um eine Absenz von Schwebungen zu erreichen, ist nur gerechtfertigt bei einer ziemlich bewegungsarmen Musik. In der Praxis ist das ein gefährliches Opfer, das sich nur selten lohnt. Die Blechbläser können beim Spielen von Abschlusstönen ein hohes Mass an Schönheit wahrnehmen, wenn sie sich der natürlichen Terz nähern, dies allerdings nur unter der Bedingung, dass alle übrigen Intervalle perfekt sauber sind. Aber die Holzbläser sollten die natürliche Terz nicht verwenden, um von benachbarten Instrumenten produzierte Schwebungen zu vermeiden, aber die den Gesamtklang des Orchesters jedoch nicht stören würden. Wenn Holzbläser die natürliche Terz inmitten eines Werkes verwenden, dann weiss nachher niemand mehr, wie hoch er spielen soll, die Quinten und Quarten sind nicht mehr sauber, und das Orchester verliert seine Durchsichtigkeit.
Das pythagoreische System hingegen, wenn es wirklich unbedingt sein muss, sollte korrekt ausgeführt werden, was wiederum bedeutet, dass man sich zwei Werte für jedes Intervall merken muss, mit Ausnahme der Oktaven, Quinten und Quarten. Man gestatte mir dazu zwei Bemerkungen: Zum einen, dass es lächerlich wäre, einen Wagner oder einen Ravel auf diese Art zu spielen; zum anderen, dass heutzutage fast kein Musiker mehr die pythagoreischen Intervalle kennt, die - ich erinnere daran - seit dem 15. Jahrhundert, nach der Einführung der harmonischen Musikpraxis, zunehmend in Vergessenheit geraten sind.
Das temperierte Spiel ist nicht zuletzt dadurch bei vielen Geigern in Verruf geraten, weil es leicht mit einer nachlässigen Spielart verwechselt werden kann, bei welcher aus Trägheit der Finger der linken Hand heraus die Intervalle verzerrt werden. Genau gesagt kommt es dabei zur Erweiterung der Halbtöne und zur Verengung der Ganztöne, was, ohne direkt falsch zu sein, doch zu äusserst unschönen Ergebnissen führt. In diesem Zusammenhang kann ich nachvollziehen, wenn auch nicht gutheissen, dass viele Geiger sich davon distanzieren und das Loblied der pythagoreischen Intonation singen; jedoch ist es ein beklagenswerter Irrtum, der temperierten Stimmung ihre Bedeutung abzusprechen.
Anmerkungen
(1) Die Vergrösserung der Oktaven und der Quarten wirkt besser als die Verengung der Quinten wegen der Inharmonizität der Klänge (siehe http://fr.wikipedia.org/wiki/Inharmonicité), wobei idealerweise nach einem Kompromiss zwischen beiden zu suchen ist. Bei der temperierten Stimmung mit reinen Quinten ergibt sich die temperierte Quarte H/leeres E dadurch, dass der erste Finger auf der A-Saite einen halben Millimeter «tiefer» gesetzt wird als die reine Quarte, und dass der dritte Finger auf der A-Saite bei der Oktave leeres D/D etwas weniger als einen halben Millimeter «höher» gesetzt wird als die reine Oktave.
(2) Eine halbe Schwebung pro Sekunde für die Quinte, ebenso für die Oktave, zum C in der Mitte der Klaviatur. Ich denke, dass sogar ein Cembalo bei modulierender Musik eine solche Stimmung vertragen würde. Für mich liegt der Vorteil dieses Systems wieder in der Präzision, die es bei den Intervallen zulässt.

