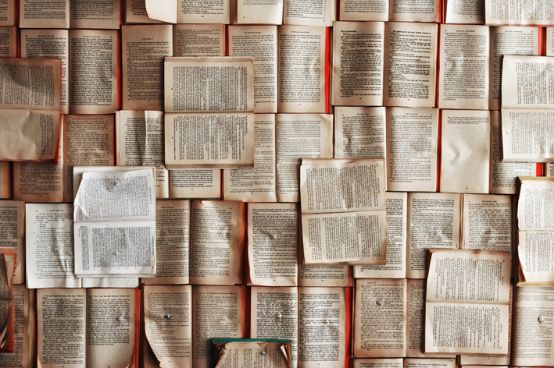
Eigentümlichkeiten der Melodieninstrumente
Im Unterschied zu den Harmonieinstrumenten, deren Stimmung durch den Stimmer festgesetzt ist, besteht bei den Melodieinstrumenten die Möglichkeit, die Intonation den Gegebenheiten anzupassen. Ausserdem werden durch den Einsatz von Vibrato, beim Spiel schneller Passagen, oder auch beim Spiel im Ensemble zusätzlich die intonatorischen Anforderungen reduziert.
Vom rein melodischen Standpunkt aus stützt sich der Instrumentalist auf das Gedächtnis seines Gehörs, um die Intervalle zu definieren; daher ist ein Intervall, das als rein definiert wird, ganz einfach ein Intervall, an das er sich gewöhnt hat und/oder das zur musikalischen Tradition seiner Kultur gehört. Ausser bei der Oktave bestimmen die Gesetze der Konsonanz nur ungefähr die melodische Intonation. Stabilität und Kohärenz werden also zu den Hauptkriterien einer guten Intonation. In der traditionellen afrikanischen Musik zum Beispiel werden die Xylofone nach intuitiven melodischen Kriterien gestimmt, die jedoch alles andere als zufällig sind: Tatsächlich würde eine «europäische» Stimmung der Musik ihren ganzen Charme nehmen.
Aber die Praxis der mehrsaitigen Instrumente und diejenige der Ensemblemusik führen im Endeffekt trotzdem zu den Notwendigkeiten der Konsonanz, und die Nachprüfung ist ein unentbehrliches Werkzeug für den Aufbau der Intonation. Der Musiker eicht regelmässig sein Gehör. Wenn er dies unterlässt, riskiert er, sich an falsche Intervalle zu gewöhnen. Der Instrumentalist kann sich zum Beispiel in seiner Intonation an einem Referenzinstrument orientieren. Es gibt keinen Zweifel, dass im Barock die Streicher die Intonation sowohl der Sänger als auch der Cembalisten imitiert haben, die damals eher reine Terzen hatten. Im Gegensatz dazu denken die Streicher von heute oft, dass die pythagoreische Reinheit, die durch reine Quarten, Quinten und Oktaven entsteht, eine Urwahrheit der Musik ist, und dass der temperierte Akkord ein schlechter unvermeidlicher Kompromiss für die Klavierinstrumente ist. Tatsächlich ist es aber umgekehrt: Die pythagoreische Stimmung stellt eine grobe Vereinfachung dar und ist daher als veraltet anzusehen, und dies nicht nur aufgrund ihrer Wolfsquinte.

